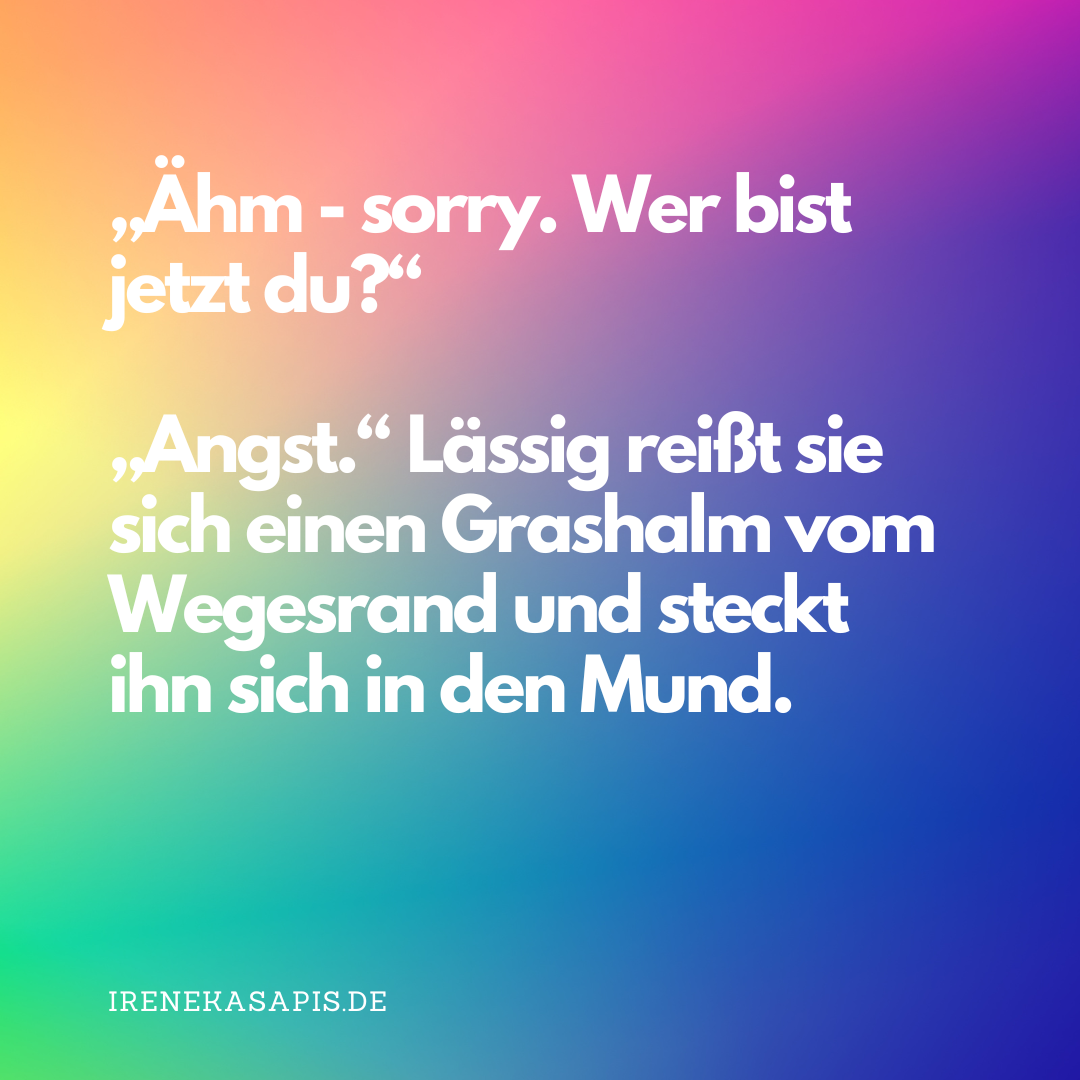Krah, Krah. Die Stimme der Angst.
Ich laufe von meinem alten zu Hause in mein jetziges zu Hause. Ich fühle mich eng, so als hätte man mich in einen zu engen Anzug gesteckt. Die Knöpfe der Blusen an meinen Hals so dicht zugeknöpft, dass ich keine Luft mehr bekomme.
Neben mir klatschen schwarze Flip-Flops auf den grauen Asphalt, der von dem heißen Tag noch glüht. Braungebrannte Beine, eine flatternde schwarze Leinenhose, eine noch schwärzere Tunika.
„Ähm sorry. Wer bist jetzt du?“ frage ich die Person, die aus meinem Schatten hervorgetreten zu sein scheint.
„Angst.“ lautet die Antwort. Lässig reißt sie sich einen Grashalm vom Wegesrand und steckt ihn sich in den Mund.
„Öhm. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich dich eingeladen habe…?“ Unsicher versuche ich, der Angst in die Augen zu blicken, was schwierig ist, da wir neben einander her laufen. Dazu verdeckt eine tiefschwarze, eckige Sonnenbrille ihre Augen ab.
„Tja… .“ Im Gleichschritt gehen wir weiter. Die Wege durch mein Viertel, die ich schon als kleines Mädchen an der Hand meiner Mutter gegangen bin. Ich weiß, dass wenn wir gleich um die Ecke biegen, da ein gelber Briefkasten steht. Dieser kam mir früher immer wie ein Wunder vor. Brief rein und schwupp. Ein paar Tage später eine Antwort.
Heute ist alles nur einen Klick entfernt. Die nächste Folge meiner Serien, E-Mails, mein Abendessen – alles ist gefühlt zehn mal schneller „da“. Warten ist ein Fremdwort geworden. Die Angst allerdings scheint alle Zeit der Welt zu haben. Ihr Schritt ist groß und langsam. Sie passt sich meinem Tempo an.
„Es ist wegen meinem Vater – richtig?“ Das griechische Wort für Zahnarzt hallt noch in meinem Kopf. Ich hatte meinem Vater meinen Duolingo griechisch Kurs auf meinem Handy gezeigt, bei dem in einer Übung ein Nikos vorkam, der Architekt ist. „Aber Nikos (mein griechischer Cousin im echten Leben) ist doch Zahnarzt.“ entrüstete sich mein Vater. Ich musste ihm erklären, dass das nur ein Beispiel war.
„Korrekt!“ Die Angst spukt den Grashalm aus. Nur um sich gleich den Nächsten vom Weg zu pflücken und zwischen die Zähne zu stecken. So weiße Zähne kenne ich nur aus dem Fernsehen – gebleicht – für die Kamera. Das hier ist aber mein echtes Leben, da gibt es kein vorspulen, wenn mir die Szene nicht gefällt.
„Er wird sterben… .“
Ich stelle der Angst keine Frage. Ich stelle diesen Satz zwischen uns. So, als würde ich ein Möbelstück in einem leeren Raum positionieren. Es ist die Wahrheit. Keiner lebt für immer. Nicht mal mein Vater, der eine echt harte Nuß ist. Nach seinem Schlaganfall vor vier Jahren entließ er sich selber aus der Reha und ging seinen eigenen Heilungsweg. Es ist die Wahrheit. Grasgrüne sehe ich den Satz vor mir. Er stinkt nach Schweiß und Desinfektionsmittel.
Die Angst plustert sich neben mir auf. Ihre flatternde schwarze Tunika erinnert mich an Amseln, die sich nach dem Bad in einer Pfütze die Flügel trocknen. Die Angst wird immer größer, ihre Klamotten wachsen mit ihr. Das Flügelschlagen schneller und schneller. Sie ist jetzt schon so groß, wie die Einfamilienhäuser, an denen wir entlang gehen. In ihrem Schatten ist mir plötzlich eiskalt. Ich zittere. Der Druck hinter meinen Augen nimmt zu. Ein sicheres Zeichen, dass ich den Tränen nahe bin – again.
Wir biegen um eine Straßenecke. Mein gelber Wunder Briefkasten kommt in Sicht. Jemand hält den Schlitz auf und starrt hinein. Es sieht ein bisschen lustig aus, wie die Person so da steht: gekrümmter Rücken, Hintern nach hinten gereckt. Die Angst schlägt mit ihren Flügeln und verliert eine schwarze Feder auf dem Weg. Doch die Szene am Briefkasten lenkt mich von ihr ab.
Die Person am Briefkasten muss uns wohl irgendwie wahrgenommen haben. Ihr Rücken streckt sich blitzschnell in die Höhe. Die Briefkasten Klappe schnalzt auf ihre Finger, den sie nicht schnell genug raus gezogen hat. „Verdammte Scheiße.“ Flucht sie, steckt sich den Finger in den Mund und lutscht hektisch daran, wie an einem Wassereis.
„Da seid ihr ja!“ Die Person kommt auf uns zu, hackt sich bei mir und meiner Angst ein und zieht sich uns weiter in Richtung meiner Wohnung. “Tod! Sterben!” Krächzt meine Angst nochmal.
„Aber nicht heute.“ Mit erhobenem Zeigefinger wackelt die Person meiner Angst vor den Augen herum. Ich erkenne sie jetzt. Es ist meine Vernunft, die ich da am Briefkasten aufgegabelt habe.
Die Angst verwandelt sich daraufhin in eine schwarze Krähe. Schwer setzt sie sich auf meine rechte Schulter. Ihre Krallen graben sich in meine Haut und tun mir weh.
Die nächsten Tage verbringe ich in einem inneren Alarmzustand. Unruhe lässt mich durch meine Wohnung tigern. Meine üblichen Bewältigungsstrategien, wie Yoga, lange Spaziergänge oder sehr viele Zigaretten, beruhigen mich einfach nicht.
„Er wird sterben.“
Ein Satz, der so schnell hier hin getippt ist und doch nagt er sich durch meine Eingeweide. Meinem Vater geht es jetzt gut. Seine gute Gesundheit ist ein Segen, über den ich mir sehr bewusst bin. Aber wie lange noch?
„Krah, Krah.“ Die Angst hat sich auf einen Ast genau gegenüber meinem Wohnzimmerfenster positioniert. Dort sitzt sie seit unserem Spaziergang. Mal hüpft in den Blättern hin und her. Mal dreht sie ihren schwarzen Kopf so, dass ihre schwarz glänzenden Augen mir in die Seele sehen. An manchen Tagen hört sich ihr “Krah Krah” auch an wie: „Allein, Allein.“ Es muss wohl an der Magie der Trauer liegen, dass ich auf einmal die Sprache der Tiere verstehe.